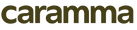Als Shila und Sebastian Eltern ihres Sohnes Rakim Elias wurden, war der Weg ins Familienleben gleichermaßen berührend und prägend. Ihre Geschichte erzählt davon, wie sie an dem festhielten, was sie liebten, die Intensität der ersten Zeit als Eltern meisterten und lernten, Grenzen zu setzen – und dabei die Identitätsveränderungen annahmen, die mit der Kindererziehung einhergehen.
Shila, die in Østerbro lebt, arbeitet als Anwältin, Sebastian als Fotograf und Musiker. Gemeinsam stützen sie sich auf das, was sie ausmacht: Neugier, Kreativität und die Liebe, die Welt zu entdecken.
Ihr Weg zur Elternschaft hat ihnen gezeigt, dass Familienleben nicht bedeuten muss, die eigene Identität aufzugeben. Im Gegenteil, es kann eine Bereicherung sein – die Identität erweitern und die Erkenntnis fördern, dass Rakims Bedürfnisse am besten von Eltern erfüllt werden, die auch ihre eigenen respektieren.
Wie verlief deine Erfahrung mit der Fütterung von Rakim Elias bisher?
Rein theoretisch war es recht unkompliziert. Ich hatte das Glück, eine fantastische Hebamme zu haben, die mir trotz des überlasteten Gesundheitssystems die Zeit und Unterstützung gab, die ich brauchte, um das Stillen zu etablieren. Dank ihr hatten wir einen guten Start.
Die Herausforderung bestand darin, dass Rakim die Flasche – und später auch den Schnuller – komplett verweigerte. Wir haben alles versucht, aber er wollte nur gestillt werden. Als er mit Beikost anfing, folgten wir den Prinzipien der babygeleiteten Beikost, gaben ihm das gleiche Essen wie uns und ließen ihn das Tempo selbst bestimmen. Das prägte auch unsere Herangehensweise an das Abstillen: Es musste in seinem eigenen Tempo geschehen. Und jetzt, mit 14 Monaten, stillen wir ihn immer noch fast genauso viel wie am Anfang, vor allem nachts.
Wie haben Sie und Sebastian die Rollen und Verantwortlichkeiten beim Füttern in den ersten Monaten aufgeteilt?
Da Rakim ausschließlich gestillt wurde, lag die Verantwortung für die Ernährung bei mir – aber das war nur möglich, weil Sebastian sich um mich kümmerte. Aufgrund meiner Geburtsverletzungen hätte ich das ohne ihn nicht geschafft. Er sorgte dafür, dass ich nahrhafte Mahlzeiten und ausreichend Wasser zu mir nahm und nahm mir die Hauptlast im Haushalt ab, sodass ich mich voll und ganz auf unseren Sohn konzentrieren konnte. Unsere Rollen waren zwar unterschiedlich, aber beide gleichermaßen wichtig, um sicherzustellen, dass es Rakim gut ging.
Wie hat es sich für jeden von Ihnen emotional angefühlt, Eltern zu werden?
Shila: Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Auf der einen Seite unendliche Liebe, Dankbarkeit und Freude über unser gesundes Baby. Auf der anderen Seite Trauer, Sorge und das tiefe Gefühl, mich selbst verloren zu haben. Ich fühlte mich oft unzulänglich, als ob ich nicht genug wäre. Es war erdrückend, diese gegensätzlichen Emotionen gleichzeitig zu tragen.
Sebastian: Für mich war es pures Glück. Während der Schwangerschaft fühlte es sich noch etwas abstrakt an, dass ich bald Vater werden würde. Aber als Rakim da war, fügte sich alles zusammen. Ich fühlte mich erst richtig vollständig, als ich ihn kennengelernt hatte.
Shila, du hast das Gefühl erwähnt, deine Identität zu verlieren. Kannst du schildern, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt und verändert hat?
Mutter zu werden, fühlte sich völlig vereinnahmend an. Meine eigenen Bedürfnisse traten in den Hintergrund, und plötzlich drehte sich alles nur noch ums Füttern, Schlafen und Spielen auf dem Bauch. Ich hatte das Gefühl, mein Leben stünde still, während Sebastian seinen gewohnten Tagesablauf ungestört fortsetzen konnte. Da ich die Hauptbezugsperson war, fühlte ich mich manchmal in der Rolle „nur“ Mutter gefangen. Es war mitunter erdrückend und überfordernd, so viel für jemand anderen und so wenig für mich selbst da zu sein.
Ich erinnere mich daran, wie allein ich mit diesen Gefühlen war. Das war schwer und manchmal sogar beschämend, weil ich befürchtete, undankbar zu wirken. Doch mit der Zeit, als Rakim selbstständiger wurde, begann ich, Teile von mir selbst zurückzugewinnen. Mir wurde klar, dass diese widersprüchlichen Gefühle – Liebe und Dankbarkeit neben Verlust und Einsamkeit – nebeneinander bestehen können. Es war ein aktiver Prozess, mich selbst als Individuum wiederzufinden, nicht nur als Mutter.
Wie haben Sie die Elternzeit aufgeteilt und wie hat sie Ihre Beziehung zu Rakim Elias geprägt?
Sebastian ist selbstständig, daher hatten wir etwas Flexibilität. Ich habe fast den gesamten Mutterschaftsurlaub genommen, während er die ersten zwei Wochen nach der Geburt betreut hat. Das bedeutete, dass ich die Hauptbezugsperson war, aber wir haben darauf geachtet, dass Sebastian Zeit mit Rakim verbrachte – besonders morgens, was zu ihrem gemeinsamen Ritual wurde.
Später, als wir während unseres Urlaubs einen Monat lang durch Japan und die Philippinen reisten, verschob sich dieses Gleichgewicht. Die gemeinsame Zeit als Familie stärkte seine Bindung zu Rakim und gab uns die Möglichkeit, die Pflege gemeinsam zu übernehmen.
Gab es im ersten Jahr besondere Herausforderungen oder schöne Überraschungen?
Reisen war ein wichtiger Punkt. Wir lieben es, gemeinsam die Welt zu entdecken, aber alle sagten uns, das sei mit einem Baby unmöglich. Anstatt aufzugeben, nahmen wir Rakim mit – und waren positiv überrascht, wie selbstverständlich es sich anfühlte, ihn einzubeziehen und ihn neue Kulturen, Speisen und all die Dinge erleben zu lassen, die wir selbst lieben.
Es hat uns gezeigt, dass Elternschaft nicht bedeutet, auf das zu verzichten, was man liebt. Wir mussten uns nur anpassen. Manchmal war es schwer – zum Beispiel, als wir ein Festival vorzeitig verlassen mussten, weil er sich weigerte, einen Gehörschutz zu tragen. Andere Male war es einfach magisch, wie zum Beispiel, als wir ihn in ein Michelin-Restaurant mitnahmen und ihm dabei zusahen, wie er genüsslich gegrillte Makrele aß. In solchen Momenten denken wir: „Deshalb tun wir das.“ Wenn wir morgens Musik anmachen und er lacht und tanzt, erfüllt uns das mit tiefer Freude. Diese Erlebnisse prägen die Freude und das Wohlbefinden unserer Familie.
Welchen Einfluss hatte es auf Ihre Familienidentität, Ihre Leidenschaften in die Elternschaft einzubringen?
Es war eine großartige Erfahrung. Natürlich muss Rakim nicht reisen, in Restaurants gehen oder Ausstellungen besuchen. Aber er braucht glückliche Eltern. Und wir haben gelernt, dass es für ihn genauso wichtig ist, unsere eigenen Bedürfnisse zu respektieren wie für uns.
Für uns bedeutet Familienleben nicht, unser früheres Ich auszulöschen. Es geht vielmehr darum, es zu erweitern – die Dinge, die wir lieben, in unser neues Leben als Eltern einzubringen. Dieses Gleichgewicht lässt uns alle aufblühen.
Welchen Rat würdest du anderen frischgebackenen Eltern geben?
Vertraue dir selbst. Schütze deine Grenzen. Rückblickend wünschten wir, wir wären in den ersten Wochen mutiger gewesen, Grenzen zu setzen. Nach Rakims Geburt fiel es uns sehr schwer, Besuchern, insbesondere der Familie, absagen zu können. Wir wollten es allen recht machen, aber was wir wirklich brauchten, war Ruhe und Zeit, um uns in unserer neuen Familie einzuleben. In dieser Zeit wurden viele Grenzen überschritten, und wir fühlten uns völlig ausgelaugt, gerade als wir unsere Energie hätten schonen sollen.
Sich Freiräume zu schaffen ist nicht egoistisch – es ist unerlässlich. Besuche abzulehnen, selbst von Angehörigen, gibt Ihrer neuen Familie Raum zum Durchatmen und um sich besser kennenzulernen. Sich eine Zeit lang zurückzuziehen, schmälert nicht die Liebe anderer; es respektiert auch Ihre Bedürfnisse.
Haben Sie im Rückblick das Gefühl, dass die Elternschaft Ihnen eine neue Identität gegeben oder Ihre bereits vorhandene erweitert hat?
Wir würden sagen, wir haben uns weiterentwickelt. Im Kern sind wir immer noch dieselben Menschen mit denselben Werten. Aber die Elternschaft hat neue Facetten hinzugefügt. Manche Aspekte unseres alten Selbst haben sich verändert, besonders bei mir (Shila), die das Gefühl hatte, ihr „altes Ich“ sei mit Rakims Geburt verschwunden.
Doch anstatt uns selbst zu verlieren, sehen wir es jetzt als eine Erweiterung. Die Elternschaft hat nicht ausgelöscht, wer wir waren – sie hat uns zu etwas Größerem gemacht.